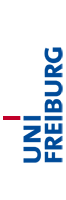Veranstaltungskommentar
Jüngeren Filmtheorien zufolge erscheinen Monster im Horrorfilm als Figuren der Exzentrizität, der latenten Bedrohung oder Ordnungsdurchbrechung von Psychologien und kulturellen Ordnungen (Arno Meteling). Doch welche Sinnsysteme setzen Medien und Diskurse der Neuzeit voraus, wenn sie Monstrosität als Einbrechen des Fremden oder Jenseitigen inszenieren? Dieser Frage möchte das Seminar in Hinblick auf die literarische Imagination von Monstrosität im Mittelalter nachgehen.
Schon in der Antike verstand die Medizin unter dem Begriff 'monstra' Menschen und Tiere mit angeborenen Fehlbildungen. Reisebeschreibungen und Naturschilderungen (Megasthenes, Plinius, Solinus) versetzen ganze Völkerschaften von Monstern in exotische Länder an die Grenzen der Erde, so etwa die Skiapoden (Menschen, die nur einen großen Fuß besitzen, auf dem sie mit höchster Geschwindigkeit laufen und der ihnen Schatten spendet), Kynokephaloi (Menschen mit Hundeköpfen), Lebewesen ohne Kopf oder Tiere mit tödlichem Blick, die noch in frühneuzeitlichen Weltbüchern in Indien oder der libyschen Wüste vermutet werden. Doch werden Monster von mittelalterlichen Autoren nicht bestaunt oder als Exponenten einer radikal fremden Welt (des Hässlichen oder des Schrecklichen) repräsentiert, sondern als verstehbare Zeichen (lat. 'monstrum' = Wahrzeichen) der eigenen kulturellen Logik interpretiert. Anders als in der Neuzeit scheint dabei für mittelalterliche Autoren in erster Linie der Zeichencharakter von Monstern deren Verstehbarkeit zu garantieren: Nicht was Monster zeigen, sondern wie Monster in mittelalterlichen Texten zeigen, ist daher die Leitfrage des Seminars, das der Semiotik mittelalterlicher Monstrosität gewidmet ist.
Anhand exemplarischer Monsterdarstellungen in der mittelhochdeutschen Romanliteratur (Heinrich von Neustadt, "Apollonius von Tyrus"), in hagiographischen Reiseberichten ("St. Brandans Reise"), Exempelsammlungen ("Gesta Romanorum", Kap. 175: "De diversitate et mirabilibus mundi") sowie naturkundlichen und kosmographischen Enzyklopädien vom 12. bis zum 16. Jh. ("Millstätter Physiologus"; "Lucidarius"; Konrad von Megenberg, "Buch der Natur"; Sebastian Münster, "Cosmographey") sollen zentrale Deutungsrahmen rekonstruiert werden, in denen mittelalterliche Autoren Konzepte von Monstrosität entwerfen. Wie verändern sich die Darstellungsverfahren des Monströsen im Spätmittelalter? Welche kulturellen Verschiebungen reflektieren diese Veränderungen und inwiefern schaffen sie die Voraussetzungen für symbolische Ordnungen der Neuzeit, in die Monster als Bedrohung des Eigenen von einem Außen her einbrechen können? Mit einem Ausblick auf Funktionen mittelalterlicher Monstrosität am Kirchbau (Wasserspeier, Kapitellfiguren) möchte das Seminar versuchen, diese Fragen auch auf andere Medien der mittelalterlichen Kultur hin zu öffnen.
Schon in der Antike verstand die Medizin unter dem Begriff 'monstra' Menschen und Tiere mit angeborenen Fehlbildungen. Reisebeschreibungen und Naturschilderungen (Megasthenes, Plinius, Solinus) versetzen ganze Völkerschaften von Monstern in exotische Länder an die Grenzen der Erde, so etwa die Skiapoden (Menschen, die nur einen großen Fuß besitzen, auf dem sie mit höchster Geschwindigkeit laufen und der ihnen Schatten spendet), Kynokephaloi (Menschen mit Hundeköpfen), Lebewesen ohne Kopf oder Tiere mit tödlichem Blick, die noch in frühneuzeitlichen Weltbüchern in Indien oder der libyschen Wüste vermutet werden. Doch werden Monster von mittelalterlichen Autoren nicht bestaunt oder als Exponenten einer radikal fremden Welt (des Hässlichen oder des Schrecklichen) repräsentiert, sondern als verstehbare Zeichen (lat. 'monstrum' = Wahrzeichen) der eigenen kulturellen Logik interpretiert. Anders als in der Neuzeit scheint dabei für mittelalterliche Autoren in erster Linie der Zeichencharakter von Monstern deren Verstehbarkeit zu garantieren: Nicht was Monster zeigen, sondern wie Monster in mittelalterlichen Texten zeigen, ist daher die Leitfrage des Seminars, das der Semiotik mittelalterlicher Monstrosität gewidmet ist.
Anhand exemplarischer Monsterdarstellungen in der mittelhochdeutschen Romanliteratur (Heinrich von Neustadt, "Apollonius von Tyrus"), in hagiographischen Reiseberichten ("St. Brandans Reise"), Exempelsammlungen ("Gesta Romanorum", Kap. 175: "De diversitate et mirabilibus mundi") sowie naturkundlichen und kosmographischen Enzyklopädien vom 12. bis zum 16. Jh. ("Millstätter Physiologus"; "Lucidarius"; Konrad von Megenberg, "Buch der Natur"; Sebastian Münster, "Cosmographey") sollen zentrale Deutungsrahmen rekonstruiert werden, in denen mittelalterliche Autoren Konzepte von Monstrosität entwerfen. Wie verändern sich die Darstellungsverfahren des Monströsen im Spätmittelalter? Welche kulturellen Verschiebungen reflektieren diese Veränderungen und inwiefern schaffen sie die Voraussetzungen für symbolische Ordnungen der Neuzeit, in die Monster als Bedrohung des Eigenen von einem Außen her einbrechen können? Mit einem Ausblick auf Funktionen mittelalterlicher Monstrosität am Kirchbau (Wasserspeier, Kapitellfiguren) möchte das Seminar versuchen, diese Fragen auch auf andere Medien der mittelalterlichen Kultur hin zu öffnen.